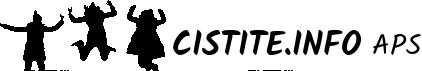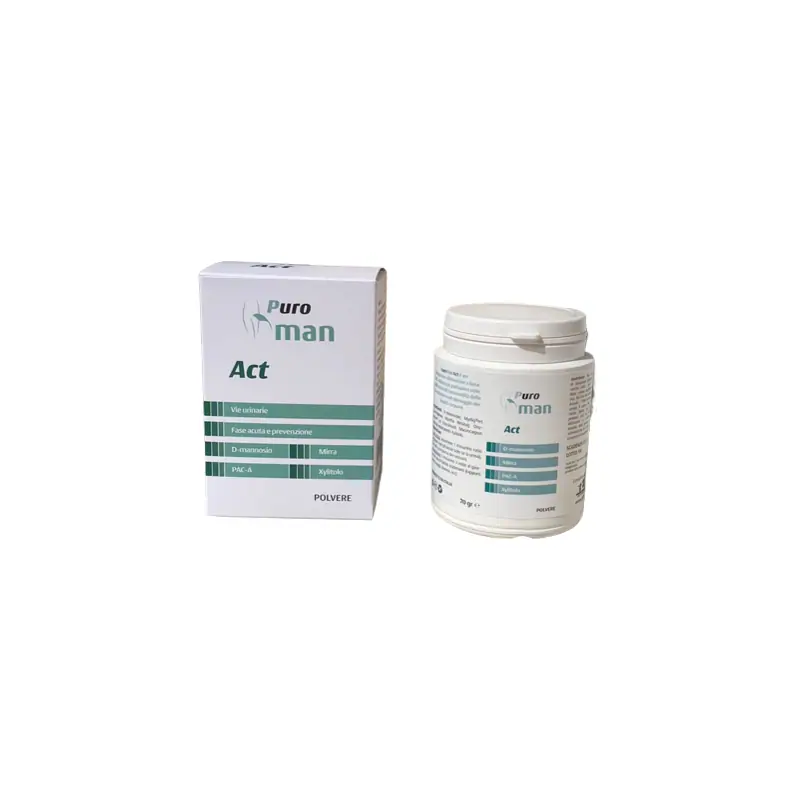Die interstitielle Zystitis (IC) oder Blasenschmerzsyndrom (BPS) ist ein chronisches Syndrom, das durch die fortschreitende Zerstörung der innersten Schicht der Blase (GAG-Schicht) gekennzeichnet ist. Dadurch reagiert die Blase zunehmend empfindlich auf Reize und verursacht Symptome wie: häufiges Wasserlassen, starken Harndrang, suprapubische Schmerzen, stark eingeschränkte Blasenkapazität und Nykturie.
Die Therapie erster Wahl für dieses Syndrom, also diejenige, die den größten Nutzen bei geringstem Risiko bringt, ist die Veränderung bestimmter Gewohnheiten (Ernährung, Miktionsgewohnheiten, Sport usw.) und die Anwendung geeigneter Verhaltensstrategien.
Ernährung
Einige Lebensmittel können die Symptomatik verschlimmern, insbesondere in Fällen, in denen der Parsons-Kaliumtest positiv ausgefallen ist und somit eine erhöhte Durchlässigkeit des Urothels vorliegt. Welche Lebensmittel diese Beschwerden auslösen, ist jedoch sehr individuell. Deshalb empfiehlt es sich, zunächst auf gut verträgliche Lebensmittel zurückzugreifen (Magerkäse, Birnen, Reis, Kartoffeln, Nudeln, frischer Fisch, Huhn, nicht-saure Gemüse- und Obstsorten usw.) und anschließend jeweils ein weiteres Nahrungsmittel hinzuzufügen, um besser beurteilen zu können, ob es die Symptome verschlimmert.
Im Allgemeinen gelten statistisch gesehen jene Lebensmittel als am meisten reizend, die stark säurebildend oder reich an Oxalaten sind: saure, alkoholische und kohlensäurehaltige Getränke, Kaffee und Tee, Tomaten, Gewürze, Schokolade, Zitrusfrüchte und künstliche Süßstoffe.
Wenn die auslösenden Lebensmittel identifiziert sind, müssen sie nicht zwangsläufig ganz von der Ernährung ausgeschlossen werden. Kleine Mengen, die gelegentlich verzehrt werden, verursachen möglicherweise keine Probleme. Wichtig ist, dass eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung von großer Bedeutung ist.
Es wurde eine leichte Besserung durch die Einnahme von Natriumhydrogencarbonat nach den Mahlzeiten beobachtet.
Vertiefung: Blasenentzündung - Ernährung in 6 Punkten
Flüssigkeitszufuhr
Bei erhöhter Miktionsfrequenz, also häufigem Wasserlassen, kann eine Verringerung der Flüssigkeitszufuhr helfen, die Zahl der täglichen Blasenentleerungen zu reduzieren. Ab dem späten Nachmittag weniger zu trinken, verhindert häufiges nächtliches Aufwachen zum Entleeren der Blase.
Wenn der Urin sehr konzentriert ist und dadurch stark reizend wirkt, kann eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr helfen, da dadurch die darin enthaltenen reizenden Substanzen stärker verdünnt werden.
Empfohlen wird stilles, vorzugsweise alkalisches Wasser.
Zu vermeiden sind kohlensäurehaltige und gesüßte Getränke sowie industriell hergestellte Fruchtsäfte.
Blasentraining
Dabei wird die Blase schrittweise daran gewöhnt, die Zeit zwischen den einzelnen Blasenentleerungen zu verlängern, indem Entspannungs- und Ablenkungstechniken eingesetzt werden.
Verzicht auf Rauchen
Rauchen belastet den Körper mit Giftstoffen, die auch über die Nieren ausgeschieden werden und somit in die Blase gelangen. Es ist der Hauptrisikofaktor für Blasenkrebs und wirkt extrem reizend auf die Blasenwände.
Konventionen für Mitglieder
Sportliche Aktivitäten
Trotz Schmerzen, Müdigkeit, erhöhter Frequenz und Harndrang sollte man sich körperlich betätigen, da dies sowohl die körperliche Symptomatik als auch die damit verbundene Depression verringert. Sport lenkt nicht nur von dem erkrankten Organ ab, sondern setzt auch Endorphine frei, die Schmerzen lindern.
Unter den empfohlenen Aktivitäten ist Yoga die wichtigste.
Nicht empfohlen werden: Radfahren, Pilates und alle Sportarten, die die Bauchmuskulatur stärken.
Stressabbau
IC/BPS führt zu Stress, Ängste und Depressionen, die wiederum die Schmerzschwelle senken. Stress setzt zudem Cortisol frei, das die Immunabwehr schwächt und die Schmerzempfindung verstärkt.
Indem man Stressfaktoren reduziert oder lernt, den durch sie verursachten Stress zu bewältigen, nimmt der Schmerz ab.
Hilfreich sind dabei grundlegende Entspannungstechniken, Yoga, Meditation, Selbsthypnose, entspannende Massagen und Musiktherapie.