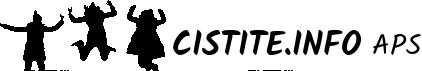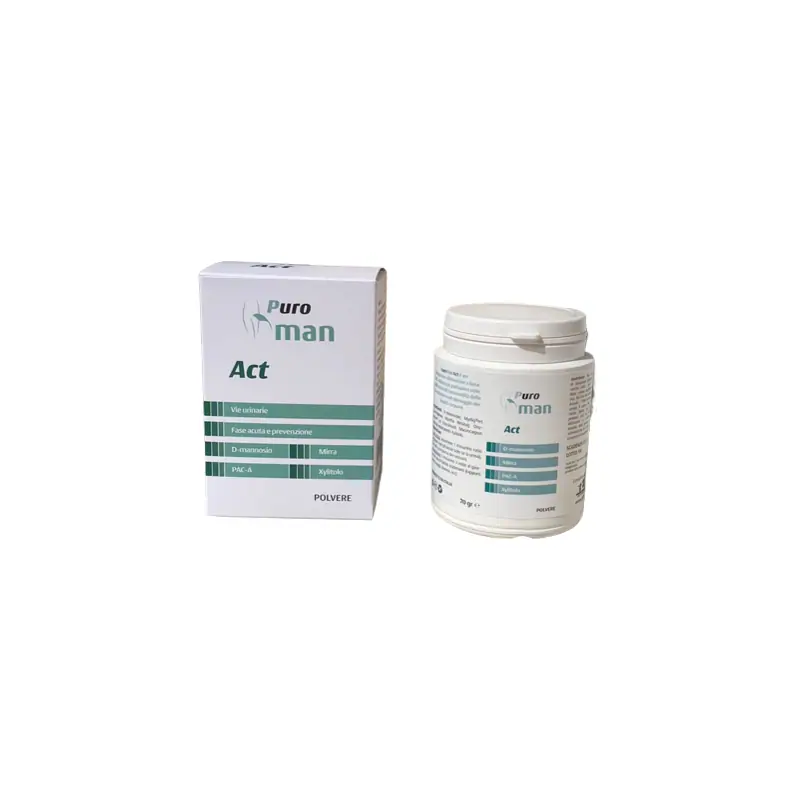Die interstitielle Zystitis oder das Blasenschmerzsyndrom wird durch die Degeneration des Blasengewebes verursacht, das sich so weit ausdünnt, dass sich Geschwüre bilden.
Neben den offiziellen Therapien gibt es Behandlungen, die sich noch in der experimentellen Phase befinden, aber sehr vielversprechend sind: die hyperbare Sauerstofftherapie, Liposomen und Vaginalpessare.
Hyperbare Sauerstofftherapie – HBO
 Die hyperbare Sauerstofftherapie (HBO) ist eine nicht-invasive Behandlung, die auf der Atmung von 100% reinem Sauerstoff über eine Maske in einer Überdruckkammer beruht, also in einer Kammer mit erhöhtem Umgebungsdruck.
Die hyperbare Sauerstofftherapie (HBO) ist eine nicht-invasive Behandlung, die auf der Atmung von 100% reinem Sauerstoff über eine Maske in einer Überdruckkammer beruht, also in einer Kammer mit erhöhtem Umgebungsdruck.
Diese Therapie ermöglicht eine bis zu zehnfach höhere Sauerstoffkonzentration im Blut im Vergleich zum Normalwert. Der erhöhte Druck außerhalb des Körpers bewirkt, dass der hochkonzentrierte Sauerstoff die Blutgefäße (wo er im Überschuss vorhanden ist) verlassen und in die Gewebe eindringen kann, in denen weniger Sauerstoff vorhanden ist. Dadurch wird die Bildung neuer Blutgefäße sowie das Nachwachsen gesunden Gewebes angeregt, das die geschädigten Bereiche repariert.
Darüber hinaus hat die HBO entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkungen, steigert die Wirksamkeit von eventuell eingesetzten Antibiotika, verbessert das Immunsystem, stimuliert die Testosteronproduktion (bei Männern) und unterstützt die Wundheilung.
Eine Sitzung dauert 90 Minuten und besteht aus drei 20-minütigen Zyklen, in denen Sauerstoff geatmet wird, unterbrochen durch Pausen von jeweils 10 Minuten, in denen die Maske abgenommen und normale Luft geatmet wird. Die ersten 5 und die letzten 5 Minuten dienen dem Druckauf- und -abbau in der Kammer.
Das Protokoll für interstitielle Zystitis sieht 30–40 tägliche Therapiesitzungen bei 2,5 ATA (Atmosphären – entsprechend dem Druck in 15 Metern Tiefe unter dem Meeresspiegel) vor.
Bisher sind Fallzahlen und verfügbare Daten zu dieser Therapie noch gering, und die hyperbare Behandlung gilt weiterhin als experimentell. Die bisherigen Ergebnisse wirken jedoch vielversprechend.
In einer Studie wurde eine Verbesserung von Häufigkeit, Harndrang und Schmerzen über einen relativ langen Zeitraum (15–24 Monate) festgestellt, bei guter Verträglichkeit und nur wenigen (leichten) Nebenwirkungen.
Liposomen
Liposomen sind biokompatible und nicht toxische Mikrovesikel, die aus einer Doppelschicht von Phospholipiden bestehen, identisch mit denen, die die Zellmembranen bilden. Ihre Fähigkeit, sich an die Zelloberfläche anzulagern und dort einen Schutzfilm zu bilden, macht sie hilfreich bei der Reparatur von geschädigtem Gewebe.
Außerdem ermöglichen sie, in ihnen enthaltene Substanzen direkt in die Zelle zu transportieren.
Die Anwendung kann sowohl oral als auch intravesikal erfolgen.
In einer aktuellen Studie wurden Patienten mit interstitieller Zystitis mit intravesikalen Instillationen von Liposomen behandelt. Dabei zeigte sich nicht nur, dass diese Instillation keine Nebenwirkungen wie Symptomverschlechterung, Inkontinenz oder Infektionen verursachte, sondern auch, dass eine zweimal wöchentliche Behandlung bereits in den ersten vier Wochen sehr gute Ergebnisse lieferte – insbesondere, wenn die Behandlung in einer akuten Schmerzphase begonnen wurde.
Leider schränken das Fehlen einer Placebo-Kontrollgruppe sowie die geringe Teilnehmerzahl die Übertragbarkeit der Ergebnisse ein. Dennoch deuten die Resultate darauf hin, dass Liposomen aufgrund ihrer reparativen und antioxidativen Eigenschaften, Schmerzen, Häufigkeit und Harndrang verbessern, eine vielversprechende Option zur Behandlung der interstitiellen Zystitis und anderer Blasenerkrankungen sein könnten.
Konventionen für Mitglieder
Vaginalpessare
Pessare sind Hilfsmittel, die in die Vagina eingeführt werden können – entweder zum Stützen der Beckenorgane oder zur lokalen Verabreichung verschiedener Wirkstoffe (z. B. intravaginale Kontrazeptiva).
Vaginalpessare können für die Behandlung des BPS/IC eine interessante Behandlungsoption darstellen, da sie mit verschiedenen Wirkstoffen (z. B. Pentosanpolysulfat, Hyaluronsäure usw.) beladen werden können. Diese Substanzen werden dann entweder direkt durch die Vaginal- bzw. Rektalschleimhaut aufgenommen oder entfalten lokal eine reparative, entzündungshemmende oder antimikrobielle Wirkung.
Bisher wurden Vaginalpessare nur mit wenigen Substanzen getestet, sie scheinen jedoch mehrere Vorteile zu bieten – vor allem die Möglichkeit, gastrointestinale Nebenwirkungen zu vermeiden, die bei einigen Wirkstoffen unvermeidlich auftreten.