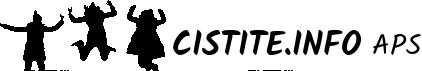Damit eine vaginale Infektion entstehen kann, müssen die Krankheitserreger zunächst in der Lage sein, den Genitalbereich zu erreichen. Dies wird durch verschiedene Barrieren erschwert (denen sie auf dem Weg zur Vagina begegnen) und unter normalen Bedingungen verhindert.
Die Intimbehaarung stellt das erste physische Hindernis dar, dem die Erreger begegnen. Danach werden sie durch das Eingreifen der vaginalen Sekrete bekämpft.
Diese Sekrete bieten besonders günstige Bedingungen für nützliche Bakterien, die Laktobazillen genannt werden. Diese wiederum beeinflussen das vaginale Milieu, indem sie es optimal für ihr eigenes Überleben und für das Wohlbefinden des Organs gestalten.
Vaginalsekrete
Sie stammen von den Plattenepithelzellen (also jenen, die die oberste Schicht der Vaginalwand auskleiden) sowie von Drüsenzellen. Diese Sekrete erfüllen äußerst wichtige Schutzfunktionen:
- Sie enthalten Glykogen, das sowohl von den Zellen der Vaginalschleimhaut als auch von den Laktobazillen durch einen Fermentationsprozess in Milchsäure umgewandelt wird. Die Milchsäure hält den vaginalen pH-Wert niedrig und schafft so ein ideales Umfeld für nützliche Mikroorganismen. Die Menge an Glykogen ist proportional zur Östrogenkonzentration: Je höher der Östrogenspiegel, desto mehr Glykogen ist in den Sekreten enthalten. In den Wechseljahren und im frühen Kindesalter ist der Östrogenspiegel sehr niedrig, der pH-Wert entsprechend höher und die Anzahl der Laktobazillen gering.
- Der vaginale Schleim ist sehr dicht. Für Bakterien ist es äußerst schwierig, in diesen Schleim einzudringen. Daher stellen die Vaginalsekrete, die die Vagina auskleiden, eine wirksame physische Barriere dar, die von pathogenen Bakterien nicht durchdrungen werden kann.
- Der vaginale Schleim enthält Fibronektin – ein Molekül, das eine starke und spezifische Bindung an Laktobazillen eingeht.
- Das vaginale Sekret ist reich an Makrophagen (Zellen, die Bakterien „fressen“; sie nehmen während der Menstruation zu und verringern sich bei Kontakt mit Spermiziden) und Antikörpern (IgA und IgE), die krankheitserregende Mikroorganismen angreifen.
- Die Vaginalsekrete sind reich an Substanzen, die für Krankheitserreger toxisch sind (Chemokine, Zytokine, Defensine) mit einem breiten Wirkungsspektrum. Sie wirken gegen grampositive und gramnegative Bakterien, Pilze, Protozoen und einige Viren.
- Sie enthalten außerdem Lactoferrin (bindet das vorhandene Eisen und entzieht es so den Bakterien, die ohne Eisen nicht überleben können), Zink (mit antibakteriellen Eigenschaften) und Lysozym (ein Enzym, das die Zellwände von Bakterien zerstören kann).
- Sie enthalten Laktobazillen, wichtige Bakterien, die mit krankheitserregenden Keimen konkurrieren.
Konventionen für Mitglieder
Laktobazillen
Laktobazillen wurden 1892 von Döderlein entdeckt und sind die zahlreichsten Mikroorganismen in unserer Vagina. Ihre Anzahl reicht von einer Million bis zu 100 Millionen!
Diese Flora, die als Döderlein-Flora bezeichnet wird, besteht hauptsächlich aus: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus casei, Lactobacillus cellobiosus, Lactobacillus leichmannii, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus salivarius.
Es handelt sich um grampositive, nicht krankheitserregende Bakterien, die sowohl in sauerstoffreicher als auch in sauerstoffarmer Umgebung überleben können – sowohl in saurem als auch in alkalischem Milieu (wobei letzteres ihnen wichtige Nährstoffe wie Glykogen entzieht).
Die Funktionen dieser Bakterien im vaginalen Bereich sind vielfältig und grundlegend. Ein Rückgang der Laktobazillen in der Vagina begünstigt das Wachstum pathogener Keime und somit das Auftreten von Vaginitis, bakterieller Vaginose, sexuell übertragbaren Krankheiten und Candida. Ein Überschuss an Laktobazillen kann hingegen zu Zytolyse führen.
Wichtige Funktionen der Laktobazillen:
- Sie fermentieren Glykogen (das durch Östrogene aktiviert wird) zu Milchsäure, was zur Aufrechterhaltung eines sauren pH-Werts in der Vagina beiträgt.
- Sie produzieren Wasserstoffperoxid, das das Wachstum anaerober (also ohne Sauerstoff lebender) pathogener Bakterien hemmt. Es wirkt aber auch toxisch auf aerobe Bakterien, sofern diese nicht zur Gruppe der Laktobazillen gehören. Besonders produktiv sind hier Lactobacillus crispatus und Lactobacillus jensenii. Am empfindlichsten gegenüber Wasserstoffperoxid sind Gardnerella, Escherichia coli und Staphylococcus aureus. Einige Wasserstoffperoxid bildende Laktobazillen sind auch gegen Neisseria gonorrhoeae wirksam, da sie Substanzen bilden, die die Überlebensfähigkeit dieses Keims bei Anwesenheit von Wasserstoffperoxid reduzieren.
- Sie produzieren Bakteriozine, natürliche antibiotische Substanzen. Lactobacillus casei rhamnosus GRI bildet besonders wirksame Bakteriozine gegen E. coli, Lactobacillus salivarius hingegen andere, welche sehr wirksam gegen Enterococcus faecalis sind.
- Sie ernähren sich von denselben Substanzen, die auch anaerobe pathogene Mikroorganismen benötigen (z. B. Arginin), und entziehen diesen somit die Nahrungsgrundlage. Lactobacillus brevis ist hier besonders effektiv und daher bei anaerober Vaginose empfehlenswert.
- Sie produzieren biosynthetische Tenside (Biosurfactants) – Moleküle, die andere Laktobazillen anziehen und so eine Barriere gegen Krankheitserreger bilden. Lactobacillus acidophilus und Lactobacillus fermentum produzieren z. B. Surlactin, das die Anhaftung von Enterococcus faecalis, E. coli und Candida albicans verhindert.
- Sie binden sich an Rezeptoren der Vaginalschleimhaut und blockieren diese, wodurch sich krankheitserregende Keime nicht mehr an die Vaginalwände anheften können.
- Sie koaggregieren, das heißt, sie binden sich direkt an krankheitserregende Keime und verhindern so deren Anheftung an die Schleimhäute und deren Vermehrung. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus gasseri und Lactobacillus jensenii binden sich zum Beispiel an Candida albicans, E. coli und Gardnerella vaginalis.