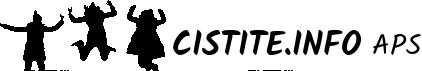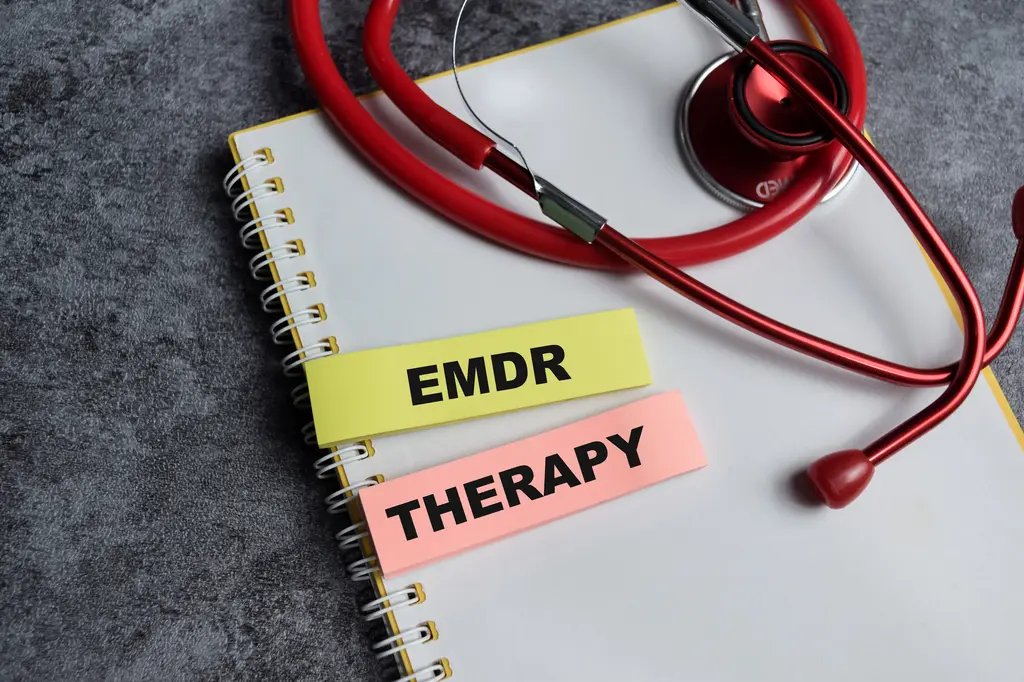Verfasst von Dr. Alexandra Monica Ulmer
Psychologin, Psychotherapeutin
Erkrankungen des Beckenbodens sind auch heute noch wenig bekannt und werden oft nicht ernst genommen. An einer Beckenbodenerkrankung zu leiden bedeutet, in einen Strudel aus körperlichen und seelischen Schmerzen hineingezogen zu werden.
- Was ist die EMDR-Therapie?
- Die psychosozialen Auswirkungen
- Welche therapeutische Behandlung gibt es?
- Die Rolle der Vereine
Was ist die EMDR-Therapie?
Psychotherapeutische Unterstützung spielt eine zentrale Rolle, da sie den Heilungsprozess nachhaltig fördern kann.
Heute verfügen wir über ein besseres Verständnis der Funktionsweise des Gehirns, was zur Entwicklung wirksamer psychotherapeutischer Behandlungsmethoden beigetragen hat.
Eine dieser Methoden ist EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Worin besteht die EMDR-Therapie? Es handelt sich um einen besonders geeigneten Ansatz, da er es ermöglicht, emotional belastende Erlebnisse gezielt zu bearbeiten und diese zu desensibilisieren – das bedeutet, sie so zu verarbeiten, dass sie nicht länger als belastend empfunden werden.
Die Therapie arbeitet mit Erinnerungen, Körperempfindungen, Wahrnehmungen und Emotionen. Ziel ist es, den natürlichen Prozess der Verarbeitung der im Gedächtnis gespeicherten Informationen wiederherzustellen.
Vertiefung: Chronische Beckenschmerzen
Die psychosozialen Auswirkungen
Haben Beckenbodenerkrankungen Auswirkungen auf die Lebensqualität?
Ja, sie gehören zweifellos zu den belastenden Erfahrungen, die Angst und Furcht hervorrufen können.
Betroffene fühlen sich oft gefangen, ohne eine Perspektive auf Besserung. Die Angst kann sich zu einer Erwartungsangst entwickeln – etwa vor dem Reisen, dem Verlassen des Hauses oder vor Geschlechtsverkehr.
Oft führt das dazu, dass Betroffene ihr soziales Leben aufgeben, was zu sozialem Rückzug führen kann.
Viele berichten von einem Gefühl der Hilflosigkeit angesichts der ständigen körperlichen Schmerzen. Dieser Schmerz beeinträchtigt den Alltag erheblich und kann sogar zu Depressionen führen.
Die Auswirkungen auf die Lebensqualität sind also gravierend, auch die berufliche Tätigkeit kann dadurch zu einem Problem werden.
Auch die Partnerschaft wird häufig belastet: Die Erkrankung kann zu Beziehungs- und Sexualproblemen führen. Nicht immer hat der Partner oder die Partnerin ein ausreichendes Verständnis für die Problematik.
Der körperliche Schmerz wird häufig unterschätzt, und das Nachlassen des sexuellen Verlangens wird oft als persönliche Zurückweisung empfunden. So entstehen Kommunikationsprobleme, die von Unverständnis, Einsamkeitsgefühlen und Frustration geprägt sind.
Welche therapeutische Behandlung gibt es?
Es ist hilfreich, einen geschützten Raum zu haben, in dem man über diese belastenden Erfahrungen sprechen und daran arbeiten kann.
Ausgehend von der aktuellen Situation werden persönliche Ressourcen gestärkt und es werden Strategien erlernt, um mit Krisensituationen besser umzugehen. Belastende Erlebnisse aus der Vergangenheit und Gegenwart werden gezielt desensibilisiert, mit dem Ziel, wieder ein Gefühl von Selbstkontrolle zu erlangen.
Dabei wird in die Vergangenheit zurückgegangen und nach negativen Erfahrungen gesucht, die die Symptome verstärken. Auch diese im Körper gespeicherten problematischen Erinnerungen werden desensibilisiert.
Ein gesteigertes Bewusstsein hilft dabei, das Gefühl von Kontrolle zurückzugewinnen. Wer lernt, sich selbst wertzuschätzen, kann sich auch besser um die eigene Gesundheit kümmern.
Das kann zum Beispiel die Einnahme eines passenden Medikaments sein, geeignete körperliche Bewegung, die Nutzung von Hilfsmitteln (wie speziellen Sitzkissen), eine angepasste Ernährung oder andere unterstützende Maßnahmen.
Inzwischen wissen wir, wie sehr unsere Lebenserfahrungen und Beziehungen in der Kindheit beeinflussen, was unser Körper als angenehm oder schmerzhaft empfindet.
Die Vorteile einer solchen therapeutischen Behandlung zeigen sich nicht nur in der Beziehung zum eigenen Körper, sondern auch in den emotionalen Beziehungen, insbesondere in der Partnerschaft. Gerade im Bereich der Sexualität kann ein besseres Verständnis für die eigenen negativen Muster und deren gezielte Desensibilisierung zu bedeutenden Verbesserungen führen. Es ist bekannt, dass Beckenbodenerkrankungen die Sexualität erheblich beeinträchtigen und dass Frauen dabei häufig mit intensiven Schuldgefühlen kämpfen.
Daher ist es wichtig, gezielt das Selbstwertgefühl der betroffenen Frauen zu stärken, sie über ihre Erkrankung aufzuklären und Ängste sowie Gefühle der Isolation abzubauen.
Konventionen für Mitglieder
Die Rolle der Vereine
In diesem Zusammenhang bietet der Verein "cistite.info" ein wertvolles Gemeinschaftsgefühl und ermöglicht es den Betroffenen, der gesellschaftlichen Stigmatisierung zu entkommen, indem sie Erfahrungen und Informationen teilen.