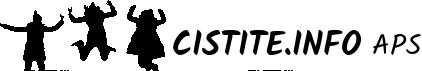Vaginale Infektionen können entweder durch Mikroorganismen entstehen, die aus dem eigenen Körper stammen (z.B. aus dem Darm oder der Vagina selbst), oder durch Mikroorganismen, die von außen eindringen.
Mikroorganismen aus dem eigenen Körper
Infektionen, die durch Mikroorganismen verursacht werden, die bereits im Körper vorhanden sind, lassen sich in vier Typen unterteilen:
- Aerobe Vaginitis: Infektionen, die durch aerobe Bakterien hauptsächlich intestinalen Ursprungs verursacht werden
- Anaerobe bakterielle Vaginose: Die häufigste Form vaginaler Infektionen, verursacht durch eine übermäßige Vermehrung anaerober Bakterien aus der vaginalen Flora.
- Candida-Mykosen: Eine Infektion durch Candida-Pilze – normalerweise harmlose Mikroorganismen, die unter bestimmten Bedingungen ihre Form verändern und pathogen werden können.
- Zytolyse: Eine übermäßige Anzahl an Doderlein-Laktobazillen kann das vaginale Gleichgewicht stören, den pH-Wert zu stark senken (ansäuern) und dadurch die Schleimhautzellen schädigen.
Es handelt sich hierbei nicht um klassische Infektionen, sondern um eine übermäßige Besiedlung von Mikroorganismen, die natürlicherweise in der Vagina vorkommen. Dabei kann das normale Verhältnis von 1:10 zwischen pathogenen Keimen und Laktobazillen kippen und zugunsten der Erreger umschlagen.
Konventionen für Mitglieder
Mikroorganismen von außen
Hierbei handelt es sich um Keime, die nicht natürlicherweise im Körper vorkommen, sondern durch sexuellen Kontakt mit einer infizierten Person übertragen werden. Aus diesem Grund werden diese Infektionen als sexuell übertragbare Krankheiten (STDs) bezeichnet. Sie können viral (z. B. Herpesviren, HPV), bakteriell (z. B. Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae) oder protozoisch (z. B. Trichomonas vaginalis) sein.
Einige STDs werden durch Mikroorganismen verursacht, die über die Geschlechtsorgane in den Körper gelangen, ohne lokale Schäden im Genitalbereich zu verursachen. Stattdessen befallen sie andere Organe, wie etwa bei HIV/AIDS sowie Hepatitis B und C.
Eine Candida-Mykose sowie eine Infektion mit Mykoplasmen/Ureaplasmen zählen nicht zu den sexuell übertragbaren Krankheiten. Diese Erreger sind bereits Teil der normalen vaginalen Bakterienflora und benötigen keinen menschlichen Überträger für eine Infektion.
Die häufigste vaginale Infektion ist die bakterielle Vaginose, gefolgt von Candida-Mykosen, aerober Vaginitis und schließlich sexuell übertragbaren Infektionen.
Infektionsorte und Symptome
Die Erreger können die Schleimhäute der Vulva, Vagina, des Gebärmutterhalses und/oder der Gebärmutter befallen. Dies führt zu Beschwerden wie intensivem Brennen (vulvär und/oder vaginal), Dyspareunie, Juckreiz und veränderten vaginalen Ausfluss (nicht mehr klar und durchsichtig, sondern gräulich, weißlich oder gelblich). Häufig betrifft die Infektion auch den äußeren Abschnitt der Harnröhre (den nach außen gerichteten Teil) sowie die Paraurethraldrüsen. Dadurch ähneln die Symptome eher denen einer Blasenentzündung als denen einer vaginalen Infektion: Brennen beim Wasserlassen, Gefühl einer unvollständigen Blasenentleerung, Harndrang und häufiges Wasserlassen.
Vom Harnröhreneingang kann sich die Infektion bis zur Blase ausbreiten und eine echte Blasenentzündung verursachen. Oft wird dann nur die Blasenentzündung mit Antibiotika behandelt – was das vaginale Infektionsproblem sogar verschlimmern kann. Das vaginale Ungleichgewicht (verstärkt durch das Antibiotikum selbst) bleibt bestehen und schafft optimale Bedingungen für weitere Blasenentzündungen und Vaginalinfektionen.
Bei wiederkehrenden Blasenentzündungen sollte daher unbedingt auch die vaginale Flora untersucht werden, um auszuschließen, dass eine Veränderung der vaginalen Bakterienflora die Ursache der chronischen Infektionen ist.
In solchen Fällen ist es besonders wichtig, einen Vaginalabstrich zu machen, um den pH-Wert und die Menge der vorhandenen Laktobazillen zu überprüfen.